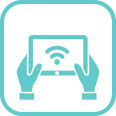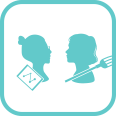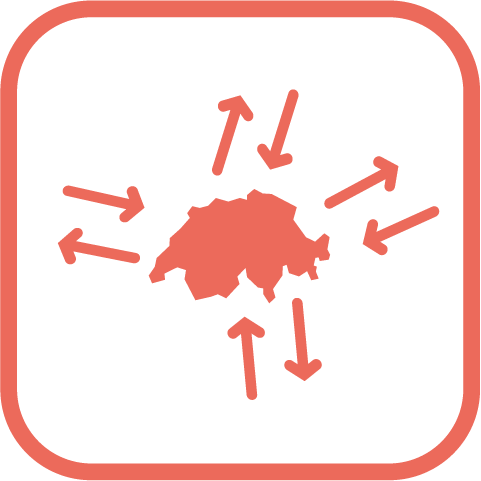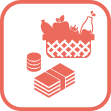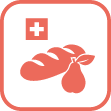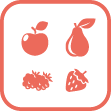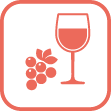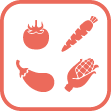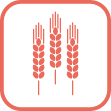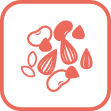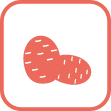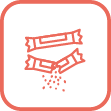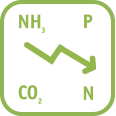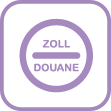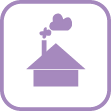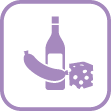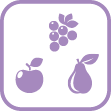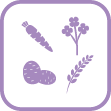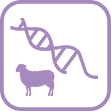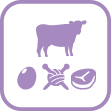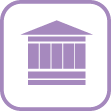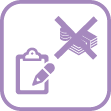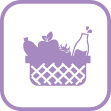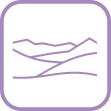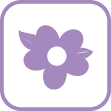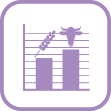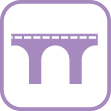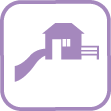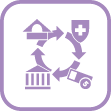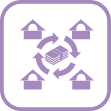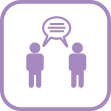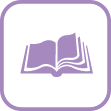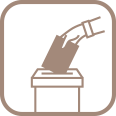Biodiversitätsbeiträge
Im Jahr 2024 machten die Biodiversitätsförderflächen (BFF) durchschnittlich 19,9 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus – leicht mehr als im Vorjahr. Auf Ackerflächen blieb der BFF-Anteil zwar gering, stieg jedoch deutlich an. Aufgrund geringerer Beiträge in der Qualitätsstufe I zahlte der Bund 3,8 Prozent weniger Biodiversitätsbeiträge als 2023.

Entwicklung der Biodiversitätsbeiträge 2024
Im Jahr 2024 richtete der Bund rund 433 Millionen Franken Biodiversitätsbeiträge aus. Dies entspricht rund 16 Prozent der gesamten Direktzahlungen. Die Biodiversitätsbeiträge flossen zu 33 Prozent in die Qualitätsstufe I (Q I), zu 40 Prozent in die Qualitätsstufe II (Q II) und zu 27 Prozent in die Vernetzung. Nachdem die Gesamtsumme der Biodiversitätsbeiträge in den vergangenen Jahren angestiegen ist, verzeichnete sie dieses Jahr einen Rückgang um 3,8 Prozent gegenüber den Beiträgen im 2023. Der Rückgang zeigt sich in der Abnahme der ausbezahlten Beiträge für Q I um 13,7 Prozent. Diese Abnahme ist auf die Senkung der Q I‑Beitragsansätze im Jahr 2024 für die drei BFF-Typen extensiv genutzte Wiese, wenig intensiv genutzte Wiese und Uferwiese zurückzuführen. Im Vergleich dazu haben die ausbezahlten Beiträge für Q II um 1,5 Prozent und jene für die Vernetzung um 2,6 Prozent zugenommen.
Die folgende interaktive Grafik zeigt die Entwicklung der Biodiversitätsbeiträge nach BFF-Typen. Die Daten können nach Jahr, Kanton, Zone, Produktionsform, sowie nach Beitragsart (Q I, Q II und Vernetzung) gefiltert werden.
Entwicklung der Biodiversitätsbeiträge (2014–2024)
Übersicht über die ausbezahlten Beiträge 2024, aufgeteilt nach Art des Beitrags (Q I, Q II und Vernetzung), Kantonen und landwirtschaftlichen Zonen:
Übersicht über die Beitragsansätze 2024 je BFF-Typ, aufgeteilt nach Art des Beitrags (Q I, Q II und Vernetzung) und landwirtschaftlichen Zonen:
Entwicklung der Biodiversitätsförderflächen
Die Summe der Biodiversitätsförderflächen ist gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. Die Fläche der Qualitätsstufe I hat um 3,7 Prozent zugenommen, diejenige der Qualitätsstufe II um 0,3 Prozent. Die Vernetzungsfläche hat um 3,5 Prozent abgenommen. Die Flächenentwicklung der Qualitätsstufe l ist zu einem grossen Teil auf die Zunahme des BFF-Typs Getreide in weiter Reihe zurückzuführen.
Die folgende interaktive Grafik zeigt die Entwicklung der Biodiversitätsförderflächen nach BFF-Typen. Die Daten können nach Jahr, Kanton, Zone, Produktionsform, sowie nach Beitragsart (Q I, Q II und Vernetzung) gefiltert werden.
Entwicklung der Biodiversitätsförderflächen (2014–2024)
Informationen zu den einzelnen BFF-Typen
Die folgenden interaktiven Grafiken zeigen die Entwicklung der Fläche und der Anzahl Betriebe der einzelnen BFF-Typen. Die Daten können nach Jahr, Kanton, Zone und Produktionsform gefiltert werden.
Biodiversitätsförderflächen Q I: Entwicklung der Flächen und der Anzahl Betriebe (2014–2024)
Biodiversitätsförderflächen Q II: Entwicklung der Flächen und der Anzahl Betriebe (2014–2024)
Biodiversitätsförderflächen Vernetzung: Entwicklung der Flächen und der Anzahl Betriebe (2014–2024)
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Anzahl Betriebe, die Flächen und die ausbezahlten Beiträge der einzelnen BFF-Typen.
Anteil der Biodiversitätsförderflächen an der landwirtschaftlichen Nutzfläche
Der durchschnittliche Anteil der BFF an der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) betrug über alle Zonen hinweg 18,1 Prozent. Werden die Hochstamm-Feldobstbäume sowie die Einzelbäume und Alleen mit einer Are pro Baum mitgerechnet, beträgt der BFF-Anteil an der LN 19,9 Prozent. Mit 46,4 Prozent wies die Bergzone IV auch 2024 den höchsten Anteil BFF an der LN auf. Sowohl die flächen- als auch anteilsmässigen Unterschiede zum Vorjahr waren gering. In der Talzone konnte die flächenmässig grösste Zunahme verzeichnet werden (+0,5 % gegenüber dem Vorjahr). Dies ist insbesondere auf die schweizweite Einführung des neuen BFF-Typs Getreide in weiter Reihe auf Anfang 2023 zurückzuführen.
Landwirtschaftliche Nutzfläche, anrechenbare Fläche BFF und durchschnittlicher Anteil der BFF an der LN (in Klammern: ohne Anrechnung von Bäumen)
| Zone | Total LN [ha] | LN BFF [ha] | Anteil BFF [%]1 |
| Talzone | 473 005 | 74 697 (66 326) | 15,8 (14) |
| Hügelzone | 135 690 | 23 549 (20 282) | 17,4 (14,9) |
| Bergzone I | 114 295 | 18 479 (15 968) | 16,2 (14) |
| Bergzone II | 152 559 | 32 164 (30 093) | 21,1 (19,7) |
| Bergzone III | 79 098 | 26 627 (25 671) | 33,7 (32,5) |
| Bergzone IV | 54 678 | 25 345 (25 022) | 46,4 (45,8) |
| Total | 1 010 325 | 200 861 (183 326) | 19,9 (18,1) |
Biodiversitätsförderflächen auf Ackerland
Das Total der Acker-BFF (Bunt- und Rotationsbrache, Saum auf Ackerfläche, Ackerschonstreifen) zusammen mit den Nützlingsstreifen aus den Produktionssystembeiträgen betrug 7202 Hektaren, was 1,9 Prozent der Ackerfläche (bzw. 2,7 % der offenen Ackerfläche) entspricht. Es ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen (2023: 5044 ha, 1,3 % der Ackerfläche bzw. 1,9 % der offenen Ackerfläche). Dieser Anstieg könnte auf die angekündigte, aber nicht in Kraft getretene ÖLN-Anforderung von 3,5 Prozent BFF auf Ackerland zurückzuführen sein. Trotz dieses Anstiegs liegt der Anteil der Acker-BFF weiterhin deutlich unter dem Wert, der notwendig wäre, um die spezifische Flora und Fauna dieser Lebensräume ausreichend zu erhalten und zu fördern.
Nicht enthalten in diesen Zahlen ist die Fläche des BFF-Typs Getreide in weiter Reihe, die in diesem Jahr 14 686 Hektaren ausmachte. Dies entspricht einem Anteil von 3,8 Prozent der Ackerfläche, bzw. 5,5 Prozent der offenen Ackerfläche. Weiterhin wurden in Vernetzungsprojekten neben den oben genannten BFF-Typen auf der offenen Ackerfläche auch regionsspezifische BFF auf Ackerflächen umgesetzt. Flächenmässig fallen diese jedoch kaum ins Gewicht. Darunter zählen beispielsweise Massnahmen zur Förderung von Kiebitzen und der Anbau von Nassreis.
Zustand der Biodiversität auf der Landwirtschaftsfläche
Mit den Daten des ersten fünfjährigen Erhebungszyklus des Monitoringprogrammes «Arten und Lebensräume in der Landwirtschaft» (ALL-EMA) von Agroscope können Aussagen zum Zustand der Biodiversität im Landwirtschaftsgebiet gemacht werden. Der erste «ALL-EMA»-Bericht ist 2021 erschienen. Er basiert auf dem Erhebungszyklus 2015–2021. Der Bericht zum zweiten Erhebungszyklus (2020–2024) ist im Jahr 2025 erschienen. Erstmals ermöglichen die Veränderungen der Biodiversität zwischen dem ersten und zweiten Erhebungszyklus detaillierte Aussagen zur Entwicklung der Biodiversität auf landwirtschaftlich genutzten Flächen.
Weiterführende Informationen
Detaillierte Informationen zu den Biodiversitätsbeiträgen und zur Biodiversitätsförderung finden Sie unter Biodiversitätsbeiträge (admin.ch), im Agridea-Merkblatt Biodiversitätsförderung auf dem Landwirtschaftsbetrieb – Wegleitung sowie unter agrinatur.ch.
Detaillierte Ergebnisse zur Biodiversität im Landwirtschaftsgebiet finden Sie im ersten «ALL-EMA»-Bericht (2021) sowie im zweiten «ALL-EMA»-Bericht (2025).
Die Daten der Biodiversitätsbeiträge in den Kantonen und über die landwirtschaftlichen Zonen finden Sie auch zusammengefasst im «Download Center».
Mein Agrarbericht
Auswahl:
Stellen Sie sich Ihren eigenen Agrarbericht zusammen. Eine Übersicht aller Artikel finden Sie unter «Service».